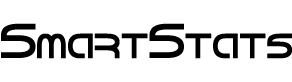Wie alt warst Du, als Du nach Deutschland kamst?
Ich war 21 Jahre alt, das war 1966. Ich war gerade mit meiner Ausbildung fertig und hatte bereits 10 Monate in einer Uni- Klinik in Seoul gearbeitet, da stand in der Zeitung, dass sie in Deutschland Krankenschwestern suchen und da habe ich mich beworben und bin hierhergekommen. Damals hatten wir sehr wenige Informationen über Deutschland, eigentlich Null. Das war schade, denn hätten wir ein bisschen mehr Informationen über das Leben hier gehabt, wäre es sicherlich einfacher für uns gewesen, hier zu leben. Hergekommen bin ich aus zwei Gründen: Erstens, weil die Bezahlung besser war und ich dadurch meinem Bruder helfen konnte, seine Ausbildung fortzusetzen, denn mein Vater war ja schon lange vorher gestorben. Der zweite Grund war, ich war noch jung und hatte Sehnsüchte oder war neugierig, ins Ausland zu gehen, vor allem nach Europa oder in westliche Länder.
Und Du bist gleich nach Berlin gekommen?
Ja. Damals war Berlin von den Alliierten besetzt und ich hatte ein bisschen Angst, da mein Vater im Korea-Krieg umgekommen ist, durch die sogenannten Kommunisten – und da ich auch anti-kommunistisch erzogen wurde, hatte ich richtig Angst, nach Berlin zu kommen. Ich wollte eigentlich gar nicht nach Berlin gehen, das von einem kommunistischen Land umgeben war (lacht). Aber damals gab es in Berlin bessere Arbeitsbedingungen als in anderen Bundesländern.
Und dann gab es ja gleich im Jahr nach Deiner Ankunft den Skandal rund um YUN Isang?
Ja, das erlebten wir auch und das war sehr erschreckend für uns. Wir hatten richtig Angst, dass wir irgendwie mit dieser Sache verbunden werden. Ich hatte auch einen koreanischen Studenten kennengelernt, der dieser Entführung knapp entkommen war und der mich zu deutschen Studentenvereinen mitnahm und Erklärungen dazu abgab. Dadurch war ich ein bisschen besser informiert als andere, aber trotzdem gingen die Ängste nicht weg.
In welchem Krankenhaus hast Du damals gearbeitet?
Ich habe in Havelhöhe gearbeitet, das ist ein Lungenkrankenhaus, also eine TBC-Klinik, dort habe ich angefangen zu arbeiten. In den ersten drei Monaten haben wir nur deutsch gelernt, und danach wurden wir auf der Station eingesetzt. Drei Monate sind nicht sehr lang. Die medizinische Arbeit ist ja ähnlich wie in Korea, aber wir mussten sehr viel pflegerische Arbeit machen, die wir in Korea nicht machen mussten, also Grundpflege, die Leute waschen, Betten machen und solche Dinge, die in Korea meist von den Angehörigen übernommen werden. Da waren auch nur ältere deutsche Krankenschwestern als ich dort anfing – unter 50 war keine – und wir Koreanerinnen waren so junge Frauen und die waren dann ein bisschen eifersüchtig, weil wir so jung waren, sehr fleißig gearbeitet haben und deshalb sehr beliebt waren bei den Patienten. Es war insgesamt ein sehr konservatives Krankenhaus, auch die Ärzte waren älter und die haben die Krankenschwestern behandelt wie Aushilfspersonal. Ich dachte schon, das wäre so üblich in Deutschland, bis ich dann nach drei Jahren ins Zehlendorfer Krankenhaus gewechselt bin, dort war eine ganz andere Atmosphäre – jüngere Schwestern, jüngere Ärzte. Dort haben sie Krankenschwestern als Fachkräfte anerkannt, nicht nur als Hilfskraft.
Und hattet ihr Krankenschwestern eigentlich viel Kontakt mit den koreanischen Bergarbeitern?
Nein, in Berlin nicht. Als wir 1966 nach Berlin kamen, gab es nur 11 männliche Studenten in Berlin. Es waren sehr wenige Koreaner in Berlin und darunter gab es keine Bergarbeiter, denn die kamen meistens ins Ruhrgebiet. Deshalb haben die in Berlin lebenden Krankenschwestern auch überwiegend Deutsche geheiratet. Wir waren ja im heiratsfähigen Alter und lernten viele deutsche Studenten kennen, darunter auch sehr viele Medizinstudenten, die in den Krankenhäusern jobbten oder als Praktikanten dort arbeiteten. Da hat man sich kennengelernt – oder auch außerhalb, da hat man durch Freunde Leute kennengelernt.
Und bei der koreanischen Frauengruppe warst Du damals von Anfang an mit dabei?
Ja. Bundesweit gegründet wurde die Gruppe 1978, aber in Berlin hatten wir damals schon ein paar Jahre vorher eine Gruppe gegründet und dort haben wir zusammen über Geschichte und über Probleme in gemischten Ehen gesprochen und als dann die ersten Kinder kamen, haben wir auch über Kindererziehung in zwei Gesellschaften diskutiert. Außerdem haben wir auch Seminare veranstaltet, in denen es um die RHEE Syngman- Regierung oder um die PARK Chung-Hee-Regierung ging – und dann bin ich auf diese Gedanken gekommen: Wieso bin ich überhaupt in Deutschland? Wer bin ich eigentlich und bin ich wirklich freiwillig nach Deutschland gekommen? Wie ist dieses Land, das ich verlassen habe, wie ist die politische, gesellschaftliche und ökonomische Lage in Korea? Dadurch bin ich dann auch auf soziale Probleme gestoßen, insbesondere im Hinblick auf den Kommunismus, da ich wie gesagt sehr antikommunistisch erzogen wurde, und als wir dann über die koreanische Geschichte sprachen, da hatte ich immer ein pochendes Herz und dachte mir immer: »Mache ich das denn richtig, was mache ich denn hier, in was für eine Gruppe bin ich denn hier geraten?« – und so hatte ich immer ein bisschen Angst, aber ich traute mich nicht, mit anderen darüber zu reden. Für mich waren die anderen Frauen auch viel weiter, vor allem durch ihre Ehemänner, die politisch engagiert waren, oder durch ihre politischen Freunde, die sehr überzeugend waren und trotzdem habe ich mir jedes Mal zu Hause gedacht: »Ach, nächstes Mal gehe ich nicht mehr hin« (lacht) – und dann bin ich doch wieder hingegangen. Das ging so bis zum Gwangju-Massaker (1980), danach bin ich diese Gedanken losgeworden, das war so gravierend, dass ich mir dachte: »Nein, jetzt nicht mehr« – und so hatte ich meine Ängste überwunden. Aber es gab auch Personen, die noch verängstigter waren als ich. Da gab es eine, die ist während eines Vortrags davongelaufen und meinte nur: »Was redet ihr hier und warum seid ihr gegen RHEE Syngman?« (lacht). Daran kann man sehen, wie ausschlaggebend die Erziehung war, die wir in Korea bekommen haben.
Du sagtest eben, Gwangju war der eine Moment, in dem es für Dich wirklich ernst wurde.
Ja, als wir dann das Gwangju-Ereignis im Fernsehen gesehen haben, da haben wir gesagt, das kann es ja nicht geben, das eigene Volk so niedermetzeln und dann haben wir gesagt, wir müssen etwas tun, wir können nicht einfach zusehen. Also haben wir – die koreanischen Studenten, die Frauengruppe und auch die männlichen Kollegen (denn damals kamen auch sehr viele Bergarbeiter nach Berlin) – zusammen eigene Aktionen gestartet. Damals habe ich auch Drohanrufe bekommen. Da sagte eine zu mir: »Du hast doch einen Gyeongsang-Akzent, warum setzt du dich für die Jeolla-do-Leute ein?1 Die Gyeongsang-Region im Osten des Landes gilt als eher konservativ, während die Jeolla-Region als Sitz der Progressiven angesehen wird. Du musst Geld verdienen und das Geld nach Hause schicken, das ist hier deine Aufgabe«. Das war unglaublich.
Und konkret? Habt Ihr Demonstrationen gemacht?
Wir haben eine Demonstration vom Ku‘damm bis zum Wittenbergplatz gemacht. Die Studenten haben einen Hungerstreik im evangelischen Studentenheim veranstaltet und dann haben wir noch einen Veranstaltungsabend gemacht – nicht nur in Berlin, sondern in mehreren Städten, in Frankfurt, im Ruhrgebiet, in Hamburg, überall. In Berlin sind auch viele Deutsche mitgelaufen. Die ARD hatte ja eine Stunde Sonderprogramm über das Massaker gebracht und dadurch hatten viele Leute gesehen, was in Korea passierte. Es kamen Studenten und christliche Gruppen haben uns auch geholfen. Das war die erste Demo in meinem Leben, auch wenn wir schon Erfahrungen mit anderen Aktionen hatten, weil wir ja schon 1978 einige davon gegen die Ausweisung koreanischer Krankenschwestern gemacht hatten. Damals hatten wir Unterschriften gesammelt, vor dem Krankenhaus, im Krankenhaus, auf der Straße – insgesamt waren es 10.000 Unterschriften, die wir gesammelt und dann beim Bundesrat eingereicht haben, denn wenn man so viele Unterschriften sammelt, dann muss das dort als Tagesordnungspunkt behandelt werden. Durch diese Aktion haben wir gewusst, wenn man sich solidarisiert, kann man auch etwas erreichen und dadurch waren die Mai-Protestaktionen für uns ein bisschen leichter, da wir schon erste Erfahrungen hatten.
Diese Aktion 1978, wie kam die zustande?
Als wir nach Deutschland kamen, waren wir sehr willkommen, denn damals gab es zu wenige Krankenschwestern. Von 1965 bis 1974 sind fast 10.000 koreanische Krankenschwestern nach Deutschland gekommen und unsere Aufenthaltserlaubnis wurde einfach automatisch verlängert, denn die wollten uns ja weiter behalten im Krankenhaus, weil wir erfahren waren, beliebt bei den Patienten, wir waren jung und damals gab es in den Medien Berichte von »freundlichen Mandelaugen in gelben Gesichtern« oder über »die Engel mit den Mandelaugen« (lacht) – und dadurch kam das automatisch, wir sind ja fast gebeten worden, dass wir länger bleiben. Aber das hat sich ab Anfang der 70er, so ab 1973, geändert, als der Ölschock kam und das wirtschaftliche Wachstum zurückging. Da brauchten sie die ausländischen Krankenschwestern nicht mehr. In Bayern wurden 17 Krankenschwestern entlassen und deren Arbeitserlaubnis nicht verlängert. Da haben wir gesagt, so etwas können wir nicht dulden, wir sind doch keine Ware! Sie haben uns doch hierher geholt und jetzt, wo sie uns nicht mehr brauchen, können sie uns nicht einfach abschieben!
Ich meine, wenn wir nach 10 Jahren nach Korea zurückgekehrt wären, hätten wir uns ja auch in Korea wieder integrieren müssen, weil uns alles so fremd geworden wäre. Da haben wir gesagt, wir gehen zurück, wenn wir wollen, aber nicht, weil ihr uns abschiebt! Und dann haben wir gesagt, wir müssen diese Aktion starten und dann haben uns viele Journalisten und auch der Caritas-Verband geholfen und wir haben eine Tagung in Köln gemacht und den Bericht an den Bundesrat geschickt.
Es war eigentlich sehr leicht, die Unterschriften zu sammeln, denn alle Leute, die wir angesprochen haben, haben unterschrieben. Keiner war dagegen. Immerhin waren wir auch schon fast 10 Jahre in Deutschland und wir haben ja auch ein bisschen zu dieser multikulturellen Gesellschaft in Deutschland beigetragen. Als wir angekommen sind, haben sie uns oft gefragt: »Seid ihr aus Vietnam, da ist doch Krieg, oder?« Die wussten gar nicht, wo Korea liegt. Das haben wir hier bekannt gemacht und auch die koreanische Küche und die koreanischen Sitten.
Während der Militärdiktatur, bist Du da oft nach Korea geflogen?
Nein, ich bin nur Ende der 70er Jahre, 1978, einmal nach Korea geflogen, als mein Sohn noch klein war, danach bis 1986 nicht mehr und auch 1986 war es ein bisschen schwierig, ob ich hinfliegen sollte oder nicht. Es waren sehr schwierige Zeiten, aber Anfang der 90er Jahre wollte ich noch einmal fliegen und da haben die aus Korea gesagt, ich solle besser nicht kommen. Die hatten irgendwie Draht zum Geheimdienst, deshalb bin ich nicht geflogen, erst 1998 wieder.
Während dieser Zeit haben wir uns sehr viel mit Arbeitergruppen und mit Wiedervereinigungsgruppen in Korea solidarisiert. Wir haben zum Beispiel jedes Jahr einen Weihnachtsbasar veranstaltet und Essen verkauft, Geld gesammelt und dann nach Korea geschickt. So konnten wir die Arbeiterinnen Projekte unterstützen. Wir haben als Frauengruppe auch sehr viele Seminare über die Arbeitsbewegung in Korea veranstaltet, wir haben uns zusammen über CHEON Tae-Il2 CHEON Tae-Il war ein südkoreanischer Arbeiter, der sich für die Rechte von ArbeiterInnen in den »Sweatshops« von Seoul einsetzte. Aus Protest gegen die Ausbeutung der Menschen in den Fabriken zündete sich der 22-jährige am 13. November 1970 während einer Demonstration an. Sein Tod machte ihn zum Märtyrer der koreanischen ArbeiterInnenbewegung. informiert, auf welche Weise er gestorben ist und wie die Lage der Arbeiterinnen in Korea ist. Als wir Krankenschwestern nach Deutschland kamen, taten wir das ja nicht in dem Bewusstsein, dass wir Arbeiter sind. Wir haben damals gedacht, wir sind ein gehobener Berufsstand! Schließlich hatten wir eine Hochschulausbildung. Durch die Solidaritätsarbeit sind wir aber zu dem Bewusstsein gekommen, dass wir irgendwie doch von der Arbeiterschicht sind: Hatten wir nicht genau das gleiche Schicksal, wie die Arbeiterinnen in Korea, die wegen der Arbeit vom Land in die Stadt gingen, um ihre Familie zu ernähren und teilten wir nicht auch die gleiche Geschichte, da wir nach Deutschland gegangen sind, um unsere Familien zu ernähren? Und dann haben wir 1984 eine Theateraufführung gemacht. »Licht der Fabrik« hieß das Stück. Es handelt von der Geschichte der Arbeiterinnen in Korea, aber diese Geschichte war zugleich auch unsere Geschichte und als wir dann den Text geprobt haben, da haben wir sehr viel geweint, denn das, was wir zu unseren Müttern sagten: »Mama, wir werden viel Geld verdienen und dann zurück kommen« war ja auch das, was die Arbeiterinnen vom Land zu ihren Müttern sagten, deshalb konnte die Theaterregisseurin mit uns nicht üben, weil wir jedes Mal so viel geweint haben! Immer bevor wir anfingen zu proben, musste sie uns ermahnen: »Bitte heute nicht weinen! Bitte heute nicht weinen!« Später haben wir dann dieses Theaterstück an sechs Orten in Deutschland aufgeführt und haben dadurch auch die Lage der Arbeiterinnen in Korea den Deutschen gezeigt.
Als Du 1998 erstmals wieder nach Korea geflogen bist, hattest Du damals schon gehört, dass es nun auch MigrantInnen gab, die in Korea lebten?
Ja, aber darüber wusste ich nicht viel. 1999 oder 2000 habe ich das erste Mal eine MigrantInnenveranstaltung besucht. Interessant war, dass man in Korea unsere Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt komplett vergessen hatte, also vergessen hatte, damals Bergarbeiter und Krankenschwestern nach Deutschland geschickt zu haben. Erst als die ersten Migranten in Korea auftauchten, erst 1994/95, haben sie festgestellt, hoppla, wir haben ja unsere eigenen Leute damals auch ins Ausland geschickt. Wie leben die denn dort überhaupt? Erst dann haben sie angefangen zu recherchieren. Erst dann! Davor hat sich überhaupt niemand dafür interessiert. Damals habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass diese Migranten in Korea so schlecht behandelt werden. Ich meine, Korea ist eine sehr homogene Gesellschaft und ich wusste, dass es da auch sehr viel Rassismus gibt, aber dass es so schlimm ist, habe ich nicht erwartet. Die Ausländer, die aus dem Westen kommen, werden zum Beispiel angehimmelt, die werden ganz anders behandelt als die Arbeitsmigranten, die jetzt nach Korea kommen. Wie können die Leute zwei so unterschiedliche Gesichter haben, das verstehe ich nicht! Ich lebe ja hier in Deutschland auch als Migrantin und mich interessiert es, wie das Leben in Korea für Migranten ist, weshalb ich auch versucht habe, regelmäßig an Symposien in Korea zu diesem Thema teilzunehmen. Als ich 2005 zum ersten Mal dabei war, waren so wenige Migranten bei diesem Symposium, dass ich mich gefragt habe: »Warum sind denn hier nur Koreaner? Warum sind hier keine Migranten? Das ist doch ihr Anliegen, nicht nur euer Anliegen«, aber als ich 2011 das letzte Mal dort war, waren schon sehr viele Migranten dabei. Michel Catuira von der MTU3 Siehe Interview mit Michel Catuira im Korea Forum 2012, S.18-21. war auch dort und andere philippinische, vietnamesische und chinesische Kollegen. Das fand ich sehr gut. Das hatte sich inzwischen richtig gut entwickelt, wie ich finde. Sie erweitern das Symposium immer mehr, auch inhaltlich. So wurden zum Beispiel bisher nur migrantische Arbeiter behandelt, die mit einem MOU-Vertrag4 Ein Memorandum of Understanding (MOU) ist eine Absichtserklärung zwischen zwei Ländern, die in diesem Fall die Einwanderung betrifft. Südkorea hat eine Vielzahl solcher bilateraler Verträge abgeschlossen, die die Arbeitsmigration aus diesen Ländern nach Korea regelt. nach Korea kamen, nicht aber die aus China kommenden Migranten. Für diese gab es dann letztes Jahr aber einen eigenen Vortrag. Ein weiteres Thema waren auch die Kinder der Migranten, denn bis dahin war der Fokus nur auf den Migranten selbst gewesen. Das war also ein echter Fortschritt.
- 1Die Gyeongsang-Region im Osten des Landes gilt als eher konservativ, während die Jeolla-Region als Sitz der Progressiven angesehen wird.
- 2CHEON Tae-Il war ein südkoreanischer Arbeiter, der sich für die Rechte von ArbeiterInnen in den »Sweatshops« von Seoul einsetzte. Aus Protest gegen die Ausbeutung der Menschen in den Fabriken zündete sich der 22-jährige am 13. November 1970 während einer Demonstration an. Sein Tod machte ihn zum Märtyrer der koreanischen ArbeiterInnenbewegung.
- 3Siehe Interview mit Michel Catuira im Korea Forum 2012, S.18-21.
- 4Ein Memorandum of Understanding (MOU) ist eine Absichtserklärung zwischen zwei Ländern, die in diesem Fall die Einwanderung betrifft. Südkorea hat eine Vielzahl solcher bilateraler Verträge abgeschlossen, die die Arbeitsmigration aus diesen Ländern nach Korea regelt.